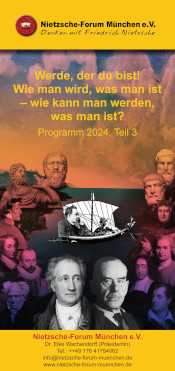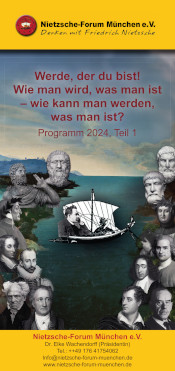Einladung: Vortrag
für Donnerstag, den 26.03.2026
um 19.00 Uhr, in der → Seidlvilla, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Barbara Straka (Potsdam)
„Nietzsche forever?“ Nietzsche-Bildnis,
-Themen und Motive in der zeitgenössischen Kunst
Buchvorstellung mit moderierter Lesung und Diskussion
Friedrich Nietzsche – kein Thema zeitgenössischer Kunst? Im Gegenteil: Barbara Straka belegt in ihrer zweibändigen Publikation*) mit thematisch strukturierten Werkbeispielen von mehr als 220 Künstler:innen seine lebendige Rezeption in der Kunst unserer Zeit. Damit widerlegt sie den populistischen Mainstream fachöffentlicher Statements, die Darstellungen Nietzsches auf traditionelle Porträts reduzieren und ihm in der Kunst heute keine nennenswerte Wirkung attestieren, bestenfalls als Witzfigur und Pop-Ikone. Vielmehr hat sich die Kunst zu Nietzsche nach 1945 eine Fülle neuer Themen und Motive erschlossen. Analog zu den Umwertungen, die sein Bildnis in der philosophischen Rezeptionsgeschichte erfuhr, hat es eine Transfiguration vom Mythos zum Menschen durchlaufen, die mit aktuell neu entstehenden Werken und mit den jüngsten KI-Bilderfindungen noch nicht an ihr Ende gekommen zu sein scheint.
Mit dem Titel „Nietzsche forever?“, einem Zitat des Schweizer Künstlers Thomas Hirschhorn folgend, stellt die Autorin die Frage nach der Bedeutung und Faszination, die Nietzsche noch immer zukommt und auf Künstler unserer Zeit ausübt. Welche neuen Zugänge und Strategien wählen sie? Welche Perspektiven nehmen sie ein? Können ihre Werke Nietzsche wirklich gerecht werden oder sind sie nur Ausdruck oberflächlicher Begeisterung für einen Modephilosophen? Können sie Nietzsches Philosophie einem breiteren Publikum vermitteln und zu einem neuen cross-over zwischen Philosophie und Kunst beitragen?
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen interessanten und lebendigen Abend.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 15,00 / Mitglieder € 8,00 / Studenten frei
Einladung: Vortrag
für Montag, den 02.03.2026
um 19.00 Uhr, in der → Seidlvilla, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Dr. Robert J. Kozljanič (München)
Der Geist eines Ortes.
Kleine philosophische Kulturgeschichte des Genius Loci.
"Als eine Art Abschluss der Reihe 'Nietzsches philosophische Ver-Ortungen' wird der Vortrag auf raumphilosophische Art in die 2500-jährige Geschichte des 'Genius Loci' einführen. Folgende Punkte werden schlaglichtartig betrachtet: Begriff und Phänomen der Ortsgeister und Ortsgötter in der Antike – Ihre Transformation in Lokalheilige und Lokaldämonen im christlichen Mittelalter – Die Bekämpfung überlieferter Genius-Loci-Konzepte in der Aufklärung – Die Wiederentdeckung des Genius Loci in der neuzeitlichen Kunst und in der phänomenologischen Philosophie des 20. Jahrhunderts. Dabei eröffnen sich Einblicke in die abendländische Geschichte der Mensch-Ort-Beziehungen. Vor dem Hintergrund dieser Mensch-Ort-Beziehungen soll abschließend raumphilosophisch gefragt werden, welcher 'Beziehungstypus' bei Nietzsches Ver-Ortungen dominierte."
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen interessanten und lebendigen Abend.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 15,00 / Mitglieder € 8,00 / Studenten frei
Einladung: Vortrag
für Montag, den 26.01.2026
um 19.00 Uhr, in der → Seidlvilla, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Dr. Helmut Heit (Weimar)
Nietzsche unter den Weimaranern
Weimar nimmt unter den „Ver-Ortungen“ Nietzsches eine besondere Rolle ein. Weder schrieb er dort relevante Teile seines philosophischen Werks, noch verbinden sich prägende Ereignisse seiner bewussten Biographie mit dieser Stadt. Unter der Obhut, bzw. Kontrolle seiner Schwester verbrachte Nietzsche die letzten drei Jahre seines Lebens in geistiger Umnachtung in der Klassikerstadt. Dennoch kam Nietzsche nicht nur zum Sterben nach Weimar. Seine posthumen Wirkungen und seine heutige Bedeutung in der Welt wurden von keinem anderen Ort im 20. Jahrhundert so stark geprägt wie von dieser kleinen Stadt in Thüringen. Nicht zufällig wählte Elisabeth Förster-Nietzsche die nationale Klassikerstadt als Ort ihrer Archiv- und Kultstätte. Aus der Villa Silberblick wurde die weltweite Rezeption Nietzsches nicht nur mit Editionen, Kriegsausgaben und einem fingierten Hauptwerk bedient, sondern auch mit Memorabilien aller Art, Kunst und Salonkultur. Von den avantgardistischen Aufbrüchen vor dem ersten Weltkrieg über die zunehmend völkisch-antidemokratische Orientierung bis in die vorbehaltlose Integration in das NS-Regime spiegeln sich in den Machenschaften des Weimarer Archivs die Ambivalenzen der Moderne. In der DDR als Vordenker des Faschismus verpönt, wurde Weimar in den 1960er und 1970er Jahr dennoch der Ort, an dem Colli und Montinari die Beschäftigung mit Nietzsche auf neue und endlich solide Füße stellten. Seit 2025 steht der vor allem in Weimar befindliche Nachlass Nietzsches als UNESCO „Memory of the World“ unter dem besonderen Schutz der Weltgemeinschaft.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen interessanten und lebendigen Abend.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 15,00 / Mitglieder € 8,00 / Studenten frei
Einladung: Vortrag
für Montag, den 27.10.2025
um 19.00 Uhr, in der → Seidlvilla, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Vivetta Vivarelli (Pisa)
„Ein Claude Lorrain, wie ich ihn nie geträumt hatte, zu sehn" –
Das herbstliche und aristokratische Turin von Nietzsche
Turin empfängt Nietzsche, der immer wieder auf der verzweifelten Suche nach einem Ort ist, an dem er die für ihn „bedenkliche und schädliche Zeit“ des Frühlings verbringen kann. Hier wird er – mit der Sommerpause in Sils Maria – die Monate vom Ende September 1888 bis zum Ende seines bewussten Lebens verbringen. Diese Zeit ist von einem großen schöpferischen Schwung gekennzeichnet. Die „würdige und ernste Stadt“ und „Residenz des 17. Jhs“ hat ihn sofort für sich gewonnen. Die Briefe aus diesem letzten Jahr zeigen einen unverkennbar euphorischen Ton und bezeugen entscheidende Ereignisse in Nietzsches Leben, wie den Anfang seines Ruhms in internationalen Kreisen, die Suche nach hervorragenden Übersetzern und „Meistern der Sprache“ sowie seinen Briefwechsel mit Strindberg. Der Schlüssel zur entscheidenden Wende in Nietzsches „Entdeckung” hat einen Namen: Georg Brandes. An ihn schreibt er: „Aber die Stadt superb ruhig und meinen Instinkten schmeichelnd. Das schönste Pflaster der Welt”. Die Eleganz und Noblesse der Stadt stecken ihn an und er versucht, sich durch einen guten Schneider an ihren Stil anzupassen. Er hört mit Begeisterung immer wieder gute Musik und entdeckt beinahe unbekannte Musiker wie Rossaro, die ihn zutiefst bewegen. Nietzsches Euphorie scheint auch aus dieser Stadt hervorzuspringen und sich in ihr zu widerspiegeln. Die Stadt, die er mehr und mehr zu seiner eigenen machen wird, fasziniert ihn durch ihren einheitlichen und aristokratischen Geschmack, aber vor allem durch ihre “energische”, “reizende, leichte, leichtfertige Luft“, ihre herbstlichen Farben, die an die Gemälde von Claude Lorrain erinnern. Mitten in der Stadt hat man den Eindruck, “direkt in die Hochgebirgswelt hineinzuschauen, als ob die Straßen darin endeten“. Alles scheint sich zu verklären, alles wird und wirkt symbolisch: die herbstliche Fülle seiner Geburtsjahreszeit, die Tatsache, dass er „wie ein Prinz“ behandelt wird und dass das Süßeste aus allen Trauben für ihn ausgesucht wird, als ob man seine dionysische Natur erahnen würde. Dasselbe wird auch in Ecce Homo erzählt, in dem das Theatralische und das Sich-in-Szene-Setzen, wie in mehreren Briefen aus Turin (und in den „Wahnsinnzetteln“), eine entscheidende Rolle spielen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen interessanten und lebendigen Abend.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und die Heidehof-Stiftung.
Einladung: Vortrag
für Montag, den 6.10.2025
um 19.00 Uhr, in der → Seidlvilla, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Joachim Jung (Sils Maria)
«Ruhe, Grösse, Sonnenlicht» -
Nietzsches Entdeckung der Engadiner «Ober-Erde»
Sieben «Arbeits-Sommer» (1881, 1883-1888), insgesamt mehr als 1 ½ Jahre, verbrachte Nietzsche in Sils Maria, jenem Ort, den er bereits bei seinem ersten Aufenthalt in Superlativen feiert und der ihm in Hinsicht auf die Ansprüche sowohl seiner Gesundheit als auch seiner geistigen Produktivität schon bald als «bewiesen» gilt. Tatsächlich ist ein grosser Teil seines Werkes hier entstanden.
Der Vortrag untersucht, wie dieser Ort und seine Umgebung in der Verschränkung mit Nietzsches vielfältigen Perspektivierungen, selektiven Wahrnehmungen und inszenatorischen Ansprüchen zu einer Art philosophischer Landschaft wurde. Zu einem Raum, dessen Formationen (Ebene, Weg, Wald, Berg, See, Gletscher, Halbinsel) und wechselnde Beleuchtungen in Nietzsches Gedankenwelt eine geistig-konzeptuelle Aufladung erfuhren, die bis heute nachwirkt. Inwieweit sind Konstruktion und Inszenierung mit am Werk, wenn Nietzsche sein Denken ver-ortet? Welchen Status haben einige seiner zum Klischee geronnenen Selbstbilder, für die ihm das Oberengadin eine Bühne bot (Hochgebirgs-Philosoph, geistiger Gipfelstürmer und Gratwanderer, Denker in Gletscherzonen, Einsiedler und Eremit, usw.)?
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen interessanten und lebendigen Abend.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und die Heidehof-Stiftung.
Einladung: Vortrag
für Montag, den 14.07.2025
um 19.00 Uhr, in der → Seidlvilla, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Simon Färber (Regensburg)
Werner-Ross-Stipendiat 2023
Ex nihilo ni…etzsche fit!
Von den neu-/platonischen und mystischen (Wahl-)Verwandtschaften des Friedrich Nietzsche
Sucht man sich dem Denken Nietzsches zu nähern, so sind die Wege dies zu unternehmen – wie es die mächtige Literatur über ihn nachdrücklich bezeugt – Legion. Im nachfolgenden Vortrag soll ein spezieller, und man könnte sagen: besonders sinistrer dieser Pfade angerissen sein, nämlich jener der Einflüsse (?) oder zumindest der Bezüglichkeiten zur Mystik und dem ihr zugrundeliegenden (Neu-)Platonismus. Auf der einen Seite also die Gedankenfelder um das mystische Dreigestirn Eckhart – Seuse – Tauler und auf der anderen Seite die neuplatonischen Konzeptionen, überliefert durch Plotin, Proklos und Pseudo-Dionysius Areopagita. Gemäß der Prägnanz des Vortrags soll sich dabei auf die jeweils Erstgenannten der Vertreter konzentriert und eine geraffte Darstellung ihrer philosophischen Grund-Fragen und Kosmogonien skizziert werden. Anschließend soll anhand ausgewählter Schriften Nietzsches aufgezeigt werden, wie und inwiefern dieser sich nicht weit fernab von mystischen und auch idealistischen Vorstellungen bewegt – oder eben doch…?
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen interessanten und lebendigen Abend.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und die Heidehof-Stiftung.
Einladung: Vortrag
für Montag, den 30.06.2025
um 19.00 Uhr, in der → Seidlvilla, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Dr. Carlotta Santini (Paris)
Die Stadt, die „in ihrem Namen etwas vom Siege hat.“
Friedrich Nietzsche in Nizza
Auf der ständigen Suche nach dem Süden, der Sonne und der reinen Luft, die er für sein körperliches und geistiges Wohlbefinden als unverzichtbar erachtete, verbrachte Nietzsche ab 1883 mehrere Winter in Südfrankreich, insbesondere in Nizza, einem Ort, den auch Sils Maria in nichts nachsteht. Hier, mit Blick auf das Meer, wo man an klaren Tagen bis nach Korsika sehen konnte, fand er die günstigsten Bedingungen für seinen Geist, wenn nicht für seine Gesundheit, und er genoss die arbeitsreichsten Zeiten seines Lebens. In Nizza kam es auch zu einer Begegnung mit dem Tod, der ersten wirklichen nach der Erfahrung des Deutsch-Französischen Krieges, als ein Erdbeben die Region Nizza und Ligurien in den Tagen des Karnevals 1887 erschütterte. Gesundheit und Krankheit als Leben und Tod sind in Nietzsches Denken jener entscheidenden Jahre miteinander verflochten. In diesem Vortrag werden wir den Spuren Nietzsches in Südfrankreich folgen. Wir werden erfahren, wie diese gleichzeitig trockenen und üppigen Orte, die von einer Vielzahl von Touristen durchquert werden, in denen man sich in völliger Anonymität verlieren kann, sein Denken und sein Werk inspiriert haben.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen interessanten und lebendigen Abend.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und die Heidehof-Stiftung.
Einladung: Ausflug
für Samstag, den 31.05.2025
Franz Krojer (München)
"Vogel Selbsterkenntnis"
Im Bayerischen Wald mit Friedrich Nietzsche und Erwin Rohde
Als Ergänzung zu dem Vortrag von Franz Krojer am 22. Mai laden wir zu einem Tagesausflug mit Wanderung vor Ort im Bayerischen Wald ein.
Die Deatils entnehmen Sie bitte der Einladung zum Vortrag am 22. Mai sowie dem Handout zu dem Ausflug.
Einladung: Vortrag
für Montag, den 26.05.2025
um 19.00 Uhr, in der → Seidlvilla, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Dr. Renate Müller-Buck (Tübingen)
„… zitternd vor bunter Seligkeit“
Nietzsche in Venedig
Zwischen 1880 und 1887 verbrachte Friedrich Nietzsche insgesamt fünfmal eine längere Zeit in Venedig. Es war die einzige Stadt die er liebte, ein "geweihter Ort" für sein Gefühl und als Stadt der "100 tiefen Einsamkeiten" ein „Bild für die Menschen der Zukunft“. Empfangen und umsorgt wurde er dabei von dem Musiker Heinrich Köselitz, dessen Lehrer er in Basel war.
Ausgehend von Nietzsches Briefen sowie von Berichten und Erinnerungen seiner Freunde und Weggefährten vermittelt Renate Müller-Buck ein Bild vom Alltag des Philosophen in Venedig und der vielfältigen, die die Bedeutung, die die Lagunenstadt in seinem Denken einnimmt. Wir begleiten ihn durch die schattigen Gässchen mit ihrem »regelmäßigen Trachytsteinpflaster«, das er als »Dreiviertelblinder« besonders liebt und folgen ihm in die Calle nova, wo Köselitz in seinem Zimmer ganze Vormittage für ihn musiziert. Und wir blättern mit ihm in seinen Venedig-Lektüren: Lord Byron, George Sand, Stendhal. Gleichzeitig werfen wir einen besonderen Blick auf das Venedig des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen interessanten und lebendigen Abend.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und die Heidehof-Stiftung.
Einladung: Vortrag
für Donnerstag, den 22.05.2025
um 19.00 Uhr, in der → Seidlvilla, Gorbach-Zimmer,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Franz Krojer (München)
"Vogel Selbsterkenntnis"
Im Bayerischen Wald mit Friedrich Nietzsche und Erwin Rohde
Im August 1867, nach dem Abschluss ihres Studiums in Leipzig, unternahmen Erwin Rohde und Friedrich Nietzsche noch eine gut zweiwöchige Bahn- und Fußreise hauptsächlich durch den Bayerischen Wald. Die einzelnen Stationen ihrer Wanderungen werden im Vortrag taggenau aus den Aufzeichnungen Rohdes und Nietzsches erschlossen und ortsspezifische Kenntnisse vermittelt. Beide haben auch Skizzen einiger Sehenswürdigkeiten hinterlassen, z.B. vom barocken Vogel Selbsterkenntnis, der noch heute sehr gut in Regen-Stadt erhalten ist. Auch darüber wird berichtet.
Am Ende ihrer Reise besichtigten die beiden noch Regensburg und die nahegelegene Walhalla und nahmen noch einige Tage an den Musikfestspielen in Meiningen teil, bevor sich ihre Wege in Eisenach trennten: Rohde zog es nach Kiel, Nietzsche nach Naumburg.
Fast zehn Jahre später, 1876, hat sich Nietzsche für gut eine Woche in den Bayerischen Wald zurückgezogen (Klingenbrunn), um Ruhe und Abstand vor den ersten Bayreuther Festspielen und Richard Wagner zu finden. Hier hat er mit den Aufzeichnungen begonnen, die sich zu Menschliches, Allzumenschliches ausweiteten. Aus jener Zeit stammt auch Nietzsches launisches Gedicht Im bayrischen Walde fieng es an, das, entstellt und anachronistisch, zum Motto des Friedrich-Nietzsche-Wanderwegs auf dem Lamberg bei Cham wurde: Alles hat im Bayerischen Wald begonnen.
Die Vortragsmaterialien können hier bereits im Vorfeld gesichtet werden.
Als Ergänzung laden wir darüber hinaus zu einem Tagesausflug mit Wanderung vor Ort im Bayerischen Wald ein - je nach Wetterlage am Samstag, den 24. Mai oder Sonntag, den 25. Mai. Details hierzu werden am Vortragabend besprochen werden, ein Handout wird verteilt werden, welches Sie aber auch schon hier herunterladen können: Handout zum Ausflug
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, auf einen interessanten und lebendigen Abend sowie auf einen erlebnisreichen Ausflug am darauffolgenden Wochenende.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und die Heidehof-Stiftung.
Einladung: Vortrag
für Montag, den 28.04.2025
um 19.00 Uhr, in der → Seidlvilla, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Dr. Elke Wachendorff (Gilching)
Erste Schritte des „freien Geistes“: „Gedanken-Gänge“ in St. Moritz.
Mit Datum vom 2. Mai 1879 versandte Nietzsche sein Demissionsschreiben für seine Altphilologische Professur an der Universität Basel an den Regierungspräsidenten, Dr. Carl Burkhardt. In größter Eile wurden in Basel, dank aufopfernder Hilfe durch Familie Overbeck, inklusive der in Zürich lebenden Schwiegermutter Overbecks, Frau Louise Rothpletz, sowie der umgehend aus Naumburg angereisten Schwester Elisabeth, fast fluchtartig die Zelte abgebrochen. Auf Anraten des Freundes Paul Widemann ging die Reise ins Oberengadin, zunächst nach Wiesen, dann über Silvaplana und Champfer nach St. Moritz. Von Sils Maria ist bis zum Sommer 1881 noch nicht die Rede.
Es sind dies nota bene die ersten Schritte in das neue Leben eines „freien Geistes“ und zugleich fugitivus errans, unbeschwert von den Gedanken an Rückkehr in den Basler Lehrbetrieb, zugleich aber auch in eine unbekannte Entwurzelung.
Während seines Aufenthaltes in St. Moritz behauptete Nietzsche in Briefen an Freunde und Familie, brav den Anweisungen des Arztes folgend nichts zu lesen oder zu schreiben. De facto entstand ein Büchlein, dass zu Weihnacht 1879 die Büchertische der Freunde schmückte, und den Titel trug: Der Wanderer und sein Schatten.
Der Vortrag wird die Ver-Ortung des Büchleins und einiger seiner wichtigsten Einsichten und Erkenntnisse mit Blick auf die topografischen Besonderheit des Ortes zu vermitteln versuchen. Zur Orientierung in das damalige Setting werden wir uns zunächst durch einige Fotografien in jene Zeit zurückversetzen können, denn damals sah es dort vollkommen anders aus als heutzutage. Doch auch die Topografie des Ortes ist von ganz besonderer Art und ebenfalls ganz anders als jene, die wir in Sils Maria bis heute antreffen können.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen interessanten und lebendigen Abend.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und die Heidehof-Stiftung.
Einladung: Vortrag
für Montag, den 31.03.2025
um 19.00 Uhr, in der → Seidlvilla, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Dr. Paolo d‘Iorio (Paris), Dr. Renate Müller-Buck (Tübingen)
Nietzsche in Sorrent: Zur Genese der Philosophie des „Freien Geistes“.
Im Herbst 1876 nimmt sich Nietzsche in Basel eine Auszeit. Seine Gesundheit liegt darnieder, er kann nicht mehr unterrichten und so verbringt er das bevorstehende Wintersemester in Gemeinschaft mit Malwida von Meysenbug und Paul Rée in Sorrent. Er nutzt die Zeit zu einer Neuorientierung. Auf langen Spaziergängen entlang der Sorrentinischen Küste verabschiedet er sich vom metaphysischen Gedankengut der Geburt der Tragödie und wendet sich neuen, naturwissenschaftlich und historisch geprägten Formen des Denkens zu. Mit Blick auf die Vulkaninsel Ischia wird ihm plötzlich klar, wie unsinnig sich seine bisherige Basler „Philologen-Existenz“ angesichts seiner eigentlichen „Aufgabe“ ausnehme. Von nun an will er nichts mehr treiben „als Physiologie, Medizin und Naturwissenschaften“. In Sorrent entsteht die Philosophie des Freien Geistes und es ist die Geburtsstunde des Psychologen Nietzsche. Von beidem zeugt Menschliches. Allzumenschliches, das Buch, das in diesem Sorrentiner Herbst und Winter entstanden ist.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen interessanten und lebendigen Abend.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und die Heidehof-Stiftung.
Einladung: Vortrag
für Montag, den 10.03.2025
um 19.00 Uhr, in der → Seidlvilla, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
PD. Dr. Peter Villwock (Sils Maria)
„Columbus Novus“: Nietzsche in Genua
Genua ist die Stadt des Meeres für Nietzsche: Hier sah er es zum ersten Mal (1876), hier sah er es auch zum letzten Mal (1888). Der paradigmantische Text dafür, zugleich eines seiner schönsten Gedichte trägt den Titel Nach neuen Meeren – in einer früheren Fassung auch Columbus Novus. Genua ist ihm die „liebste Stadt auf Erden“, und noch zuletzt, als er sein Winterquartier schon lange nach Nizza verlegt hatte, ist ihm Genova, la Superba „von unvergleichlicher bleicher noblesse und hoch über allem, was die Riviera bietet“. In selbstgewählter Eremitage vollzog er hier die entscheidende Wende seines Lebens von Bürgerlichkeit und Wagnerbegeisterung, Professur, Selbstverleugnung und Krankheit zu Entdeckertum, Carmen und Zarathustra, Heroismus und Freiheit. Kaum ein Ort war biographisch so wichtig, kaum einer auch hinterließ in seinem Werk so markante Spuren. Beiden Aspekten wird sich der Vortrag widmen (mit Bildprojektionen).
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen interessanten und lebendigen Abend.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und die Heidehof-Stiftung.
Einladung: Vortrag
für Montag, den 24.02.2025
um 19.00 Uhr, in der → Seidlvilla, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
PD. Dr. Enrico Müller (Leipzig)
Nietzsches Basler Jahrzehnt: Aufbrüche, Umbrüche, Abbrüche.
Die zwei Jahrzehnte Nietzsches geistiger Schaffenszeit nach seinem Studium lassen sich in die Dekade der Basler Professur (1869-1879) für klassische Philologie und die daran anschließende Dekade einer freien, aber unsteten philosophischen Wanderexistenz (1879-1889) unterscheiden. Seitdem und mit diesem Befund verknüpft sind in werkbiographischer Hinsicht immer wieder Philologie gegen Philosophie, die akademische gegen die freigeistige Lebensform sowie die vergleichsweise liberale, aber auch provinzielle Welt Basels gegen jene zahlreichen Schicksalsorte Nietzsches ausgespielt worden, denen wir gewisse Einsichten oder gar ganze Werke des Philosophen zuschreiben. Nietzsche selbst, so scheint es, hat die Legende einer zähen, aber schlussendlich überlebensnotwendigen Selbstbefreiung zur Philosophie aus den krank machenden Basler Verhältnissen vor allem in den letzen Schriften und manchen Briefen zumindest mit vorbereitet. Ein genauerer Blick sowohl auf die Biographie als auch auf die geistigen Zeugnisse und Selbstzeugnisse Nietzsches spricht freilich eine andere Sprache. Die zehn Basler Jahre sind nicht nur von enormer schriftstellerischer Produktivität gekennzeichnet, sie können zugleich auch als die eigentlich fundierende Phase des Stilisten, Philosophen und Europäers Nietzsche angesehen werden. Gleichzeitig und mit großer Energie wirkt der junge Professor von Beginn in verschiedene Richtungen und setzt dabei seinen Leitspruch „Werde, der Du bist“ um: Als Lehrer für griechische Sprache und Literatur wirkt er an der Universität und im Paedagogium, mit der Geburt der Tragödie will er sowohl einen Beitrag zur Erneuerung seines Fachs als auch der deutschen Kultur im Ganzen leisten, als Verfasser unzeitgemäßer Schriften sucht er den Weg in die Öffentlichkeit, während er sich bei alledem autodidaktisch mehr und mehr in die Philosophie hineinarbeitet. Der Vortrag möchte diese Zusammenhänge beleuchten und dabei die vielleicht unspektakuläre, dafür aber nachhaltige Bedeutung des Basler Jahrzehnts für Nietzsches Denken herausstellen.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Freitag, den 21.02.2025
um 19.00 Uhr, in der → Seidlvilla, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Dr. Dr. hc. mult Manfred Osten (Bonn)
„... in der Geschichte der Deutschen ein Zwischenfall ohne Folgen“ ( Nietzsche)?
Goethe als folgenloser Vordenker der Klima- Katastrophe
Der Vortrag soll zeigen, daß es Goethe ist, der Nietzsches „Forderung“ avant la lettre erfüllt: daß der Mensch wieder „treu werden müsse der Erde“ und
„guter Nachbar der nächsten Dinge“. Goethe, der als der große „Unzeitgemäße“ mehr als die Hälfte seines Lebens der Naturforschung gewidmet hat, folgt dieser Forderung,
indem er bereits vor über 200 Jahren die Möglichkeit der Klimakatastrophe erkennt. Und zwar in Gestalt inzwischen Realität gewordener Rachefeldzüge der Elemente:
als Antwort auf die faustische Hybris des Weltverbrauchs im Zeichen der fossil-energetischen Ausplünderung der Erde:
„Auf jede Weise seid ihr verloren. Die Elemente sind mit uns verschworen“ – so das Fazit Mephistos im zweiten Teil der Fausttragödie, die Goethe bewußt versiegelt hat ...
Dr. Dr. hc. mult Manfred Osten (zuletzt, und das genannte Thema vertiefend: Goethes Prophetie der Welt als „großes Hospital“. Nachwort: Peter Sloterdijk)
wird diesen singulären Weg Goethes skizzieren, mit dem er das Wort Nietzsches einlöst: „In der Geschichte der Deutschen ist Goethe ein Zwischenfall ohne Folgen“.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Montag, den 27.01.2025
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Dr. Johann Figl (Wien)
Nietzsche in Schulpforta, Bonn und Leipzig - Orte der Vermittlung „universeller Bildung“
Am Beginn einer Reihe von Vorträgen zu wichtigen Orten im Leben Nietzsches wendet sich das Interesse zuerst jener Schule und jenem Internat zu, die in dem ehemaligen Klostergebäude von Schulpforta untergebracht sind, wo er sechs Jahre seines jugendlichen Lebens verbracht hat. Dieses Gymnasium – wie auch Nietzsche selbst – strebte ausdrücklich eine „universelle Bildung“ an. Der weitere Bildungsweg Nietzsches ist von seinen Studien an den Universitäten
Bonn
und
Leipzig
geprägt.
Der Vortrag geht der Frage nach, inwiefern diese Orte und die Begegnungen dort sein Leben und seine Ansichten beeinflusst haben. Dabei sollten drei thematische Bereiche der Bildung berücksichtigt werden:
erstens
die dort jeweils gegebene
philologische Ausbildung
;
zweitens
- was weniger bekannt ist – die in diesem Kontext gegebene Vermittlung von Kenntnissen über
nichtchristliche Religionen und außereuropäische Kulturen
; und
drittens
ist auf die schon im Gymnasium beginnende und in der universitären Ausbildungszeit sich weiterhin vollziehende Begegnung Nietzsches mit
religionskritischen Autoren
einzugehen.
Einladung: Buchvorstellung und Symposium
für Samstag, den 18.01.2025
um 15.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Dr. Harald Seubert (Basel) und Andreas Mascha (München)
Integrale Anthropologie: Person und Freiheit
Am 18.1.2025 erscheint Band 2 der Integralen Anthropologie Person und Freiheit im Verlag Andreas Mascha. Diese Neuerscheinung wollen wir mit den Autoren am 18.1.25 von 15 – 18 Uhr mit einem Symposium im Nietzsche-Forum München e.V. feiern.
Die vier Autoren des zweiten Bandes der Integralen Anthropologie Person und Freiheit stellen ihre Buchbeiträge vor:
Andreas Mascha: Die Freiheitsfrage im Licht integraler Anthropologie
Prof. Dr. Günter Rager: Freiheit aus neurowissenschaftlicher und philosophischer Sicht (via Zoom)
Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: Person und Leib in der Phänomenologie Edith Steins
Prof. Dr. Harald Seubert: Subjektivität, Freiheit und Absolutheit: Wer wir sind und sein können
Weitere Informationen finden Sie in diesem → Handout .
Mit dieser Veranstaltung schließen wir sowohl an die bisherigen Veranstaltungen zur Integralen Anthropologie im Nietzsche-Forum an ( → Einführung von Andreas Mascha ) als auch an die zentrale Forschungsfrage des Nietzsche-Forums des Jahres 2024: „Werde der du bist! Wie man wird was man ist – wie kann man werden, was man ist?“. Hierzu sowie zur grundlegenden Freiheitsfrage gibt die Integrale Anthropologie zukunftsweisende Impulse. Weitere Infos zur Publikationsreihe siehe auch unter → www.IntegraleAnthropologie.de
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen interessanten und lebendigen Abend.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Buchpräsentation
für Dienstag, den 26.11.2024
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Buchpräsentation mit Rüdiger Kendziora
Rüdiger Kendziora,
Gesellschaft und Existenz. Wandlungsformen in der Postmoderne
,
Münster 2024, ISBN 978-3-86435-034-4
Rüdiger Kendziora,
Transzendenzen des Subjekts. Philosophische Sinnhorizonte menschlichen Daseins
,
Münster 2024, ISBN 978-3-86435-036-8
Perspektiven der Subjektivität –
Die fragwürdige Konzeption von „Ich“ und „Selbst/-verwirklichung“ in der (Post) Moderne
Der soziologische Befund zeigt eindeutig eine zunehmende Individualisierungstendenz der Lebensverhältnisse hin zu einer fortschreitenden De-institutionalisierung von Familie hin zu einer Diversität ganz unterschiedlicher Lebensformen und Wertpräferenzen. Begünstigt durch die Zunahme akademischer Bildungsschichten werden individuelle Anspruchshaltungen nach „Selbstverwirklichung“ generiert. Sofern jedoch aus philosophischer und psychologischer Sicht unklar ist wie und worin die praktische Entfaltung und Steuerung des Ichs und des Selbst‘s konstitutiv begrifflich und ontologisch besteht und eher Viel- und Uneindeutigkeiten zulassen wie auch Kräfte des Unbewussten mit hineinspielen, bleibt zu fragen, was hiermit in einem originären Sinn gemeint sein kann? Vor diesem Horizont sind Aspekte der Schicksalshaftigkeit und „Transzendenzen des Unbewussten“ wirksam, die die Grenzlinien vorgestellter „Selbstverwirklichung“ markieren. In diesem Kontext sind die Ausführungen zu Martin Heidegger, Helmuth Plessner, C. G Jung und Antonio Damasio aus neurowissenschaftlicher Perspektive sehr erhellend.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Montag, den 25.11.2024
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Dr. Dieter Borchmeyer (München/Heidelberg)
Nietzsche im Zwielicht von Thomas Manns Erfahrung.
Nietzsche spielt in Thomas Manns Werk und Denken von Anfang bis Ende seines geistigen Lebens eine elementare, alle seine Wege begleitende Rolle, noch bevor er sich in Schopenhauers oder Goethes Spuren begibt. Einzig Wagner hat für ihn von früher Jugend an eine gleich kontinuierliche Bedeutung in allen Phasen seines Lebens und Wirkens . Beide bilden dauerhaft ein antagonistisches Paar in seinem intellektuellen und künstlerischen Kosmos, gleichen sich für ihn dialektisch immer wieder aus. Während die Wagner-Erfahrung von Anfang an von einer reservatio mentalis geprägt ist - ganz anders als das durchgängig affirmative Verhältnis zu Schopenhauer und Goethe -, gerät das Nietzsche-Erlebnis vor dem Hintergrund des Faschismus erst im letzten Drittel von Thomas Manns Leben ernsthaft ins Zwielicht, ohne seine positive Tönung grundsätzlich zu verlieren.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Montag, den 28.10.2024
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Dr. Barbara Naumann (Zürich)
„... meiner jetzigen Bestimmung unwissend entgegenging“.
Einige Varianten der Frage nach dem Selbst bei Goethe
Nietzsches berühmter Imperativ „Werde der du bist“, stellt seine Übersetzung und Variante des berühmten Verses aus einer Pythischen Ode Pindars. Für Nietzsche gilt, dass dieser Satz unbedingt ernst zu nehmen sei. Dies trifft allerdings auf zahlreiche Autorinnen und Autoren zu, für die die Selbstreflexion ein oder sogar der Weg der Auseinandersetzung mit ihrer Kunst ist. So auch für Goethe, der durch sein gesamtes Werk hindurch immer wieder Fragen nach dem Gewordensein und Werden seiner Autorschaft, seiner Interessen, seiner artistischen und wissenschaftlichen Vermögen, seiner Liebesbeziehungen, seiner Person schlechthin gestellt hat. Der Vortrag wird einige Varianten von Goethes Selbstbefragung beleuchten, und dies vor allem in Texten mit autobiographischem Bezug. Nicht zuletzt Goethes Aufzeichnungen seiner Reisen bieten eine Fülle von Gelegenheiten, die Wendungen seiner Selbsterkundung wie auch der gelegentlichen Ablehnung eines zu tiefen Grübelns über das Ich zu beobachten.
Begleitend zum Vortrag wird die Schauspielerin Beate Himmelstoß die Originaltexte Goethes lesen.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Einladung: Diskurs- und Lektüreseminar
für Sonntag, den 22.09.2024
10.00 - 16.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Beate Himmelstoß
Nietzsche lesen und verstehen
Anhand von zentralen Textauszügen erarbeiten wir uns gemeinsam einen Zugang zu Nietzsches Philosophie. Im Mittelpunkt steht der Austausch mit Bezug zur eigenen Lebenswelt und Erfahrung, der am Text orientiert geführt wird. Es gilt, frei nach Nietzsche: "Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen"!
Bei dem Bemühen, gemeinsam dem Wesen der Welt ein wenig mehr auf die Spur zu kommen, wird das eigene "Gewordensein" und die lebensweltliche Bedingtheit der eigenen Weltanschauung bewusst; im Austausch mit anderen und in der Begegnung mit Nietzsches kulturkritischem, künstlerisch-philosophischem Denken erweitert sich der eigene Horizont.
Dieses Tagesseminar mit ausgesuchten Texten aus Nietzsches Werk richtet sich an EinsteigerInnen und bildet den Auftakt zu einer Reihe mit Nietzsches einzelnen Werken. Am Beginn steht die Lesung der Texte, die auch verteilt werden, dann steigen wir in die Debatte ein. Nietzsche-Kenner sind willkommen!
Die Schwabinger Seidl-Villa bietet ein schönes Ambiente zum gemeinsamen Philosophieren. In der Mittagspause gibt es Brot mit Aufstrichen und Getränke im Café.
Bitte beachten Sie:
Eine Anmeldung bei der Münchner Volkshochschule (MVHS) ist erforderlich!
Hier können Sie sich anmelden und die
Kursgebühr in Höhe von 39,00 €
bezahlen:
Kursnummer: S135800 - Nietzsche lesen und verstehen
Die MVHS bucht die Kursgebühr von Ihrem Konto ab. Dazu müssen Sie Ihre
IBAN und BIC
auf der Webseite der MVHS eingeben.
Information & Beratung: Dr. Robert Mucha,
Telefon (089) 48006-6560
Wir danken auch hier wie stets für die freundliche Unterstützung dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München.

Einladung: Vortrag
für Montag, den 15.07.2024
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Constantin Sinn
Werner-Ross-Stipendiat 2022
»Ich habe über den ganzen Begriff ›schönes Wetter‹ umgelernt«
Friedrich Nietzsches Wetter- und Klimaaufzeichnungen
Friedrich Nietzsche war vom Wetter getrieben. Auf seiner Suche nach halkyonischen Tagen reiste er zwischen der Schweiz, Frankreich und Italien umher und zeichnete in seinen Notizbüchern Klimadaten zu Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf. Nietzsche konsultierte meteorologische und physikalische Literatur, hantierte mit eigenen Messinstrumenten, verkehrte mit der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt und berichtete in Briefkorrespondenzen davon, wie sich die Wetterverhältnisse vor Ort auf seinen Gemütszustand und seine körperlichen Leiden auswirkten. Stefan Zweig bezeichnete Nietzsches Studium des Wetters anhand von Messungen sogar als seine ›zweite Wissenschaft‹.
Der Vortrag gibt einen Einblick in diese zweite Wissenschaft, die ich als Klimaphilologie bezeichne. Er fragt danach, wie Nietzsche zu seinem Wetterwissen kam, inwiefern es in den Klimadiskurs der Moderne eingebunden ist und wie es sich in seinen philosophischen Texten und Gedichten (z. B. im Entwurf Die Wetterwolke) gespiegelt hat.
Am Ende seiner Reise sollte aus dem Wettersuchenden ein Wettermacher werden. Als Nietzsche in der Basler psychiatrischen Klinik Friedmatt aufgenommen wurde, bedauerte er das schlechte Wetter und erklärte: »Ich will euch, ihr guten Leute, morgen das herrlichste Wetter machen.«
Wir fragen uns heute: Ist Nietzsche das gelungen?
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Wir danken an dieser Stelle ganz besonders der Heidehof-Stiftung für die großzügige Unterstützung des Werner-Ross-Stipendiums, ohne die dieses nicht mehr würde stattfinden können.
Wir danken auch hier wie stets für die freundliche Unterstützung dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München.

Einladung: Lektüresalon
für Dienstag, den 25.06.2024
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Lektüresalon im Nietzsche-Forum München e. V.
Buchpräsentation mit Prof. Dr. Harald Seubert und Dr. Kristina Schippling
"Die im Dunkeln sieht man nicht“. DDR Philosophie im Fokus von Halle/Saale
Die DDR-Philosophie wurde in den letzten drei Jahrzehnten im akademischen und öffentlichen Diskurs weitgehend tabuisiert. Das Tabu folgte auf eine teils ungerechtfertigte Abwicklung. Dieses Buch unternimmt aus unterschiedlichen Wahrnehmungen eine Revision und kritische Aufarbeitung dieser Verdeckungsgeschichte. Die beiden Autorinnen und der Autor bieten ein differenziertes Porträt dieser Philosophie, die weit über Ideologien hinausging. Vor allem Nietzsche bildete einen Fokus der Verdrängung und zugleich der Gegenläufigkeiten.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Montag, den 24.06.2024
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Dr. Harald Seubert (Basel)
Pindars Satz: werde der du bist.
„Werde, der/die Du bist“: ein Grundmotiv in der Begegnung zwischen Nietzsche und Lou Andreas Salome, das auch darüber hinaus große Tragweite besitzt, das die nicht-dialektisch abgeschlossene, fluide Selbst- und Alteritätsbegegnung bezeichnet.
Nietzsche knüpft mit einem Goetheschen Zwischenmotiv unmittelbar an den frühgriechischen Dichter Pindar (518 oder 522 v Chr- 446 v Chr) an. Die Selbstbegegnung als Selbst-Veranderung wird zum Grundmotiv der tragisch-heroischen Weisheit.
Anknüpfend an Michael Theunissens (1932-2015) magistrales Pindar-Werk (München 2000) und in Konstellation mit anderen frühgriechischen Lyrikern und Lyrikerinnen wie Sappho wird diese innere genealogische Figur gedeutet und in Nietzsches Horizonte eingeführt.
Sie können das Vortragsmanuskript hier als PDF erunterladen:
→ Download
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Montag, den 03.06.2024
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Dr. Christian Benne (Kopenhagen)
„In Blut und Sprüchen“. Wie man schreibt, was man ist
Die Frage, wie man wird, was man ist, stellt sich für Nietzsche auch und vielleicht in erster Linie als Frage der Autorschaft. Der Vortrag interpretiert Nietzsche als einen Autor auf der Suche nach einer Sprache, die gerade als philosophische nur seine Sprache sein kann. Nietzsches Suche nach seinem persönlichen philosophischen Idiom beginnt schon früh und bleibt auch später geprägt von seiner philologischen Schulung. Als zentral für das Verständnis sowohl des Werdens wie des Schreibens „was man ist“ erweist sich der Rhythmus – in Theorie und Praxis. Unter dieser Perspektive lässt sich auch das Missverständnis von Nietzsche als ‚Dichterphilosophen‘ aus dem Weg räumen.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Montag, den 06.05.2024
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Dr. Sigridur Thorgeirsdottir (Reyjkjavik)
Der Wille zu Macht, Eros und Jesus.
Überlegungen zu Nietzsche, Lou von Salomé und Sabina Spielrein
Lou von Salomé und Sabina Spielrein, beide Pionierinnen auf dem Gebiet der psychoanalytischen Theorie, sind von Nietzsche beeinflusst. Seine Philosophie war für sie ein Ansporn für die Entwicklung ihrer eigenen Theorien. Salomé und Spielrein entwickeln eine Philosophie des Eros als grundlegenden Lebenstrieb und thematisieren Eros als Zusatz und auch Gegenpol zu der antagonistischen Machtwillenlehre Nietzsches. Dabei haben Salome und Spielrein grundlegende Thesen einer gegenwärtigen feministischen Fürsorgeethik und einer Ontologie eines relationalen, interaktiven Selbst vorweggenommen. Die Gestalt von Jesus, so, wie Nietzsche sie im Antichrist als Absage an Machtkampf deutet, spielt eine Rolle in diesem Kontext, wo Grenzen der Lehre vom Willen zu Macht deutlich werden.
Frau Professor Thorgeirsdottir lehrt in Island an der Universität von Reyjkjavik, und sie wird zu uns in die Seidlvilla kommen können über eine ZOOM-Schaltung. Im Anschluß an ihren Vortrag werden wir wie stets mit ihr diskutieren können.
Für Interessenten können wir dadurch auch eine private ZOOM-Zuschaltung ermöglichen.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Wir bitten, den Beitrag bei Teilnahme per ZOOM zuvor auf das Konto des Nietzsche-Forums München zu überweisen.
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Montag, den 22.04.2024
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Dr. Claus Zittel (Stuttgart)
„Selbstkenner! Selbsthenker!“
Unter Berufung auf Formeln wie „Werde, der du bist“ oder „Erzähle dich selbst“ verharmlosen und trivialisieren nicht wenige Interpreten Nietzsches Philosophie zu einer Anleitung zur Lebenskunst. Im Graubereich des Begriffes der „Lebenskunst“ florieren heute Theorie-Ansätze, die Nietzsches Moral und Kunst zu einer neuen ästhetischen Ethik zu verschwistern suchen. Der Vortrag wendet sich gegen jene optimistische Nietzsche-Deutungen, die da meinen, es führe die Selbsterkenntnis zu einer Selbstüberwindung, Selbsterhöhung oder gar Selbstgestaltung, in Zuge derer das eigene Leben, der eigene Charakter wie ein Kunstwerk geformt werden soll. Stattdessen soll das Verhältnis von Erkenntnis, Kunst, und Ethik bei Nietzsche ausdifferenziert und das mit der Selbsterkenntnis verbundene Motiv der Tödlichkeit der Wahrheit in seinen Folgen expliziert werden.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Montag, den 18.03.2024
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Dr. Andreas Urs Sommer (Freiburg)
Werden, wer man ist? Über einige Nöte, eine Nietzsche-Biographie zu schreiben
Von keinem Denker des 19. Jahrhunderts dürfte wie im Falle Nietzsches eine derartige Fülle von Material vorliegen, das eine Biographie verwerten könnte. Wie geht der Biograph mit dieser Materialfülle um, wie und was wählt man aus? Nietzsche hat sein Leben, sein Denken und sein Schaffen von Kindsbeinen an selbst reflektiert und kommentiert. Sich von diesen – durchaus nicht widerspruchsfreien – Narrativen freizumachen, stellt, wie ein Blick in bisherige Biographien beweist, eine erhebliche Herausforderung dar.
Wie soll eine Biographie das Verhältnis von Leben und Werk gewichten? Und vor allem: Welche Kausal- oder Wechselbeziehungen postuliert eine Biographie zwischen Leben und Werk? Solchen Fragen werden wir uns an diesem Abend widmen, der das Jahresthema des Nietzsche-Forums München aufnimmt: Was heißt es, zu werden, wer man ist?
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Montag, den 26.02.2024
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
, Mühsam-Saal,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Dr. Dr. Timon Georg Boehm (Zürich)
Werde, der du bist – ein Problem der philosophischen Symptomatologie bei Nietzsche und Spinoza
Weder Nietzsche noch Spinoza sind einfache «Ratgeberphilosophen». Dennoch kann mit ihnen die Frage «Wie man wird, was man ist» auf lebensnahe Weise einer Antwort zugeführt werden. Bei Spinoza gibt es allerdings keine Freiheit im gewöhnlichen Sinne als Bedingung der Möglichkeit, um Vorsätze, Ziele und Ideale zu verfolgen. Aus menschlicher Perspektive ist eine Entwicklung deshalb nur paradox zu denken. Während bei Spinoza dafür die eigene Erkenntnisleistung zentral ist (vgl. «Die Ethik»), wäre für Nietzsche «nosce te ipsum das Recept zum Untergang» (vgl. «Ecce Homo»), sofern das Bewusstsein als blosse Oberfläche in die Irre führt. Stattdessen verfügen wir immer nur über Zeichen und Symptome tieferer Schichten und Ursachen, die gedeutet werden müssen. Für beide, Spinoza und Nietzsche, lautet die Schlüsselfrage daher nicht «Was soll ich tun?», sondern «Was drücken meine Handlungen und Affekte aus bzw. wovon sind sie Symptome?»
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Montag, den 29.01.2024
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Dr. Elke Wachendorff (Gilching)
Der Wanderer auf „Hadesfahrt“ – Friedrich Nietzsches Krisenerfahrung
Zum 1. März 1878 war ein neues Werk Nietzsches erschienen unter dem Titel „Menschliches, Allzumenschliches“, und diesem hatte er bald ein nächstes Büchlein nachgeschickt und als „Nachtrag“ bezeichnet: „Vermischte Meinungen und Sprüche“ betitelt, erschienen am 12. März 1879. Ein bemerkenswerter Aphorismus (408) schließt diesen Text ab und steht unter dem Titel: „Hadesfahrt. —“
Nietzsche präsentiert zum Abschluss seiner Bücher gerne auffallende, besondere Aphorismen, auch mal mit einem Fragezeichen endend, die auf ein kommendes, nächstes Werk verweisen, die eine Verbindung schaffen, das Interesse des Lesers und Mitdenkers wach halten möchten. Diesmal ist dieser abschließende Text aber doch etwas Besonderes, Gewichtigeres, immerhin ist eine „Hadesfahrt“ doch eine recht aussergewöhnliche Herausforderung.
Der Vortrag wird sich diesem Aphorismus ausführlich widmen mit Blick auf die damalige Lebenssituation Friedrich Nietzsches, auf den Topos und dessen wichtige Referenzen, auf die Bedeutung, die Nietzsche ihm hier beilegt und auf die Ausblicke, die er dieser Reise entnimmt.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Aktuelles - Termine 2023

Einladung: Vortrag
für Montag, den 27.11.2023
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Heike Fiedler (Genf)
Nietzsche in Venedig – langues de meehr
Als intermedial schreibende Dichterin wurde ich im Sommer 2023 im Rahmen der Nietzsche-Werkstatt nach Sils Maria eingeladen, um eine Perfomance zum Thema Nietzsche und Venedig zu realisieren. Meine Recherchen führten mich hin in diese Stadt, in meinem Notizbuch Nietzsches Gedicht «Venedig», sowie Angaben zu den Orten seiner verschiedenen Aufenthalte.
Die Ton- und Bildaufnahmen, die ich in Venedig realisiert habe, sind heute Bestandteil der Performance Nietzsche in Venedig_langues de meehr , die natürlich auch poetische Texte von Nietzsche enthält, sowie ein cut-up aus Fragmenten seiner Korrespondenzen, in denen er Venedig thematisiert.
Der im Titel der Performance enthaltene Zusatz langues de meehr verweist auf meinen 2009 in der Reihe «editions spoken skript» erschienen Gedichtband. Damit stelle ich eine Brücke zwischen meinen Gedichten und einigen Aspekten der Philosophie und der Lyrik Nietzsches her. Vom Nihilismus hin zu meinem Gedicht «alles nichts», von den Worten «An der Brücke jüngst stand ich…» hin zu «bridge», von «Nach neuen Meeren» hin zu «langues de meehr»
Es ist eine grosse Freude, die audio-visuelle Performance Nietzsche in Venedig_langues de meehr in München aufführen zu können und damit u.a. auch die Texte «Nur Narr! Nur Dichter!» oder «Klage der Ariadne» über meine Stimme zu vertonen.
Damit wird Nietzsche auch hier in die Künste der Gegenwart übersetzt. Hinübergesetzt.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Einladung: Vortrag
für Freitag, den 03.11.2023
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Dr. Virginie Séguin
(Montreal)
Werner-Ross-Stipendiatin 2019
Eine symbolische Analyse des Gemäldes Silser See, Engadin von Gabriele Münter
Silser See, Engadin (1927) ist ein Landschaftsbild, das zu den am wenigsten bekannten Werken der Deutschen expressionistischen Künstlerin Gabriele Münter gehört. Die Marginalisierung dieses Gemäldes in ihrem Werkkorpus kann erklärt werden einerseits durch die Tatsache, dass es immer im kleinen Kreis privater Sammler verblieb, andererseits dadurch, dass das Bild Silser See, Engadin in eine weniger produktive Phase von Münters Schaffen gehört, die bis heute wenig Interesse seitens der Kunsthistoriker erfahren konnte. Diese Phase entspricht dem Zeitfenster 1920-1930, eine Dekade, in der Münters Inspiration in significantem Ausmaß schwand durch eine tiefe persönliche und künstlerische Krise. Diese Krise war vornehmlich bedingt durch das Ende von Münters Beziehung zum russischen Maler Wassily Kandinsky, die auf den Ausbruch des ersten Weltkrieges im Jahr 1914 folgte. Zusätzlich zum Ende dieser Beziehung hatte der Ausbruch des ersten Weltkrieges auch die Auflösung des Blauen Reiters bedingt, jener Künstlervereinigung, in welcher Münter aktiv gewesen war.
Der Beginn einer Münter-Renaissance wird im Allgemeinen ihrer Begegnung mit dem Kunsthistoriker Johannes Eichner Ende 1927 zugeschrieben (der ab 1928 ihr neuer Lebenspartner werden sollte), oder aber auch ihrem einjährigen Aufenthalt in Paris 1929-1930. Während zutreffend ist, dass diese zwei Ereignisse eine Schlüsselrolle spielten für den neuen künstlerischen und persönlichen Impetus, den Münter in den späten 20er Jahren erlebte, werde ich in meinem Vortrag argumentieren, dass es Münters Aufenthalt in Sils Maria im August 1927 war, der den Beginn dieser ihrer Renaissance markiert. Es ist dies der Ort, der sie zu ihrem Gemälde Silser See, Engadin inspirierte, und der bekannt war als jener Ort, in dem Friedrich Nietzsche die Eingebung zu seinem Also sprach Zarathustra erfuhr.
Um dies zu belegen werde ich die unterschiedlichen Symbole analysieren, welche im Bild Silser See, Engadin enthalten sind, und aufzeigen, wie Münter die Bestandteile der Landschaft von Sils Maria verwandelte, um ihre eigene Wiedergeburt nach einer langen Krisenperiode auszudrücken. Wie wir dabei sehen werden, werden Nietzsches Schriften und das, was er für Münter darstellte – Nietzsches Philosophie entwickelte einen große Einfluß auf die Gruppe des Blauen Reiters – dabei helfen, die Bedeutung von Silser See, Engadin zu verstehen.
Der Vortrag wird in englischer Sprache gehalten werden unter dem Titel:
A symbolic analysis of the painting Silser See, Engadin by Gabriele Münter
Übersetzungshilfe kann bei Bedarf in der anschließenden Diskussion erfolgen.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Einladung: Vortrag
für Montag, den 17.07.2023
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Dr. Hansdieter Erbsmehl (Berlin)
„Nietzsche hat alles von mir geklaut“.
Friedrich Nietzsche in der Popkultur und Massenkunst
Nietzsches Philosophie und seine Lebensgeschichte haben in der Populärkultur eine eigene Dynamik entfaltet. Unabhängig von den akademischen Diskursen äußert sich diese massentaugliche Rezeption in einer Mischung aus kruden Slogans, subtiler Zivilisationskritik und allegorischem Spektakel. Mit dem Internet hat sich der „Infekt Nietzsche“ um ein Vielfaches potenziert.
Nietzsches Aneignungen erscheinen zuweilen banal, frivol, ja vulgär, doch sie sind häufig getragen von der verehrenden Anerkennung des akademischen Außenseiters und opponierenden Kritikers der Moral.
Im Mittelpunkt der live kommentierten audiovisuellen Präsentation stehen Vertonungen von Texten und Gedichten Friedrich Nietzsches sowie verehrende musikalische Zueignungen, beginnend mit Jim Morrisons „Ode to Friedrich Nietzsche“ von 1968. Begleitende Videoschnipsel mit animierten Nietzsche-Cartoons, theatralen Spielszenen und post-dadaistischen Performances versprechen einen ebenso kurzweilig-vergnüglichen wie nachdenklich stimmenden Abend.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Montag, den 26.06.2023
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Beatrix Himmelmann (Tromsö)
Nietzsche über den Willen zur Macht und die Liebe als Lebensprinzipien
Der Gedanke des Willens zur Macht spielt bis in Nietzsches letzte Texte hinein eine hervorgehobene Rolle. Den Willen zur Macht als Lebensprinzip anzuerkennen, stellt Nietzsche zufolge vor die Aufgabe, den Menschen von einem idealistisch verfälschten Selbstverständnis zu befreien. Es gelte, „den Menschen […] zurückzuübersetzen in die Natur“ und den „schreckliche[n] Grundtext homo natura“ wieder lesbar zu machen (JGB 230).
In einigen späten Texten jedoch experimentiert Nietzsche mit Entwürfen zu einer Lebenshaltung, die den Willen zur Macht unterläuft. Er veranschaulicht und analysiert sie anhand des „psychologischen Typus“ des Jesus von Nazareth. Sie gründe auf der „Liebe – ohne Abzug und Ausschluss, ohne Distanz“. Der „Gegensatz zu allem Ringen, zu allem Sich-in Kampf-fühlen“, wie sie das Leben nach dem Willen zur Macht auszeichnen, sei in Jesus zum „Instinkt“ geworden (AC 29).
Nietzsches Antichrist tastet und schreibt sich an diesen Jesus von Nazareth heran; durch die Übermalungen seiner Gestalt im Zuge einer mit Paulus einsetzenden langen und verfehlten Deutungsgeschichte hindurch sucht er die Konturen einer neuen Lebensmöglichkeit freizulegen. Eine Einstellung zu sich selbst und zur Welt, die keinen Widerstand, keine Abgrenzung oder Distanz kennt und sich nicht einmal mehr formuliert, sondern sich in der „Praktik des Lebens“ zeigt, erscheint schließlich „als einzige, als letzte Lebens-Möglichkeit“ (AC 30, 33).
Was aber ist mit einer solchen neuen Unmittelbarkeit der Liebe, wie sie Nietzsche in Aufnahme frühromantischer Denkfiguren vor Augen führt, gewonnen? Wäre mit ihr eine Rückübersetzung des Menschen in die Natur geleistet? Anders gesagt: Können und sollen wir den Weg, der vom Kindheitsparadies vor dem Sündenfall über die Unschuld eines durch den Willen zur Macht geordneten Lebens zu den Postulaten der Freiheit, des Rechts und der Moral führte, gleichsam durch alle Stufen des Geistes hindurch zurückgehen, um „zuletzt unter den Menschen und mit sich wie in der Natur, ohne Lob, Vorwürfe, Ereiferung“ zu leben? (MA I 34)
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Montag, den 22.05.2023
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Dr. Frank Bestebreurtje (Basel)
"Vielleicht in sehr verschiedenen Welten, so gleich auch die Stimmung schien."
Die Freundschaft zwischen Erwin Rohde und Friedrich Nietzsche im Spiegel ihrer Korrespondenz
Der kürzlich erschienene 4. Band von Erwin Rohdes „Briefe aus dem Nachlass“ (Olms-Verlag 2022) bietet Gelegenheit, die enge Freundschaft zwischen Nietzsche und Rohde näher zu beleuchten. Wie hat ihre Beziehung Nietzsches Auffassung und Ideal von Freundschaft und Liebe mitgeprägt? Wie hat sich ihre „Harmonie in den Grundstimmungen des Denkens und Seins“, wie es Rohde 1867 in seinem ersten Brief an Nietzsche formulierte, bis zur Entfremdung in den 1880er Jahren entwickeln können? Nach einer Einführung in Leben und Werk Rohdes und in die Publikationsgeschichte ihrer Korrespondenz, werden ausgewählte Briefstellen vorgetragen, um anhand ihrer eigenen Worte diese Entwicklung nachzuvollziehen, die in der Nietzsche-Forschung noch als „ungelöstes Rätsel“ gilt.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Montag, den 24.04.2023
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Dr. Hans Rüdiger Schwab (Münster)
Ausgriffe nach "Draußen".
Lou Andreas-Salomés vielschichtige Deutung des "Liebesproblems"
Wenn Lou Andreas-Salomé über die Liebe schreibt (was in ihrem Werk oft geschieht), geraten damit höchst unterschiedliche Bezüge in den Blick. Grundsätzlich äußert sich in der Liebe für sie stets eine Bewegung des Menschen nach "Draußen", auf etwas hin, das er selbst nicht ist und mit dem er eins werden möchte. Eine andere Person sowohl als auch die Natur oder der gesamte Kosmos können hier das Ziel sein. Der gemeinsame Zug besteht jeweils darin, dass es sich um einen Prozess handelt, der Fremdes, ebenso Lockendes wie Begehrtes, in das eigene Innere holt, auch wenn derlei (besonders im ersten Falle) nicht ohne Verwerfungen abgehen mag. Mit zahlreichen Zwischenschattierungen kreuzen sich Gläubigkeit und Wissenschaft, Biologie, Geschlecht und Mystik in dieser Urkraft des Lebens, die es zugleich zu transzendieren vermag. Der Vortrag beleuchtet diese Denkbewegung einer der klügsten Vertreter der kulturellen Moderne vom frühen Roman, der ihre Begegnung mit Nietzsche spiegelt ("Im Kampf um Gott") über umfangreiche Essays wie "Gedanken über das Liebesproblem" oder "Die Erotik" bis hin zu Verstehensrahmen aus Sicht der Psychoanalytikerin, zu der sie (als eigenständige Schülerin Freuds) schließlich wurde.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Montag, den 27.03.2023
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
PD Dr. Peter Villwock (Sils Maria)
Nietzsche komponiert:
Menschliches, Allzumenschliches als offenes Kunstwerk
"Sie hätte singen sollen, diese "neue Seele" - und nicht reden!" schreibt Nietzsche im Rückblick auf sein erstes großes Werk Die Geburt der Tragödie - "ich hätte es vielleicht gekonnt!" Seine musikalischen Werke werden allerdings bis heute meist wenig geschätzt, und auch dem Schriftsteller Nietzsche wurde teilweise ein "singulärer Mangel an architektonischem Talent" (Danto) attestiert. Der Vortrag untersucht, wie es mit Nietzsche als Komponist und Architekt seiner Werke steht - am Beispiel seines umfangreichsten Buches, das ihn auch bei weitem am längsten beschäftigte: Menschliches, Allzumenschliches . Im konkreten Nachvollzug seiner Arbeit am Werk wird sich zeigen, was er literarisch gewollt und gekonnt, wie er seine "Philosophie als die größte Musik" (Plato) komponiert hat.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Einladung: Vortrag
für Montag, den 27.02.2023
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Dr. Na Schädlich (Halle)
Zarathustras Liebe. Perspektiven aus dem vierten Teil des ›Also sprach Zarathustra‹
Nietzsche, der genauso feinsinnige wie ungehemmte Schriftsteller, bettet das Motiv der Liebe seines Zarathustras in der Erzählung Also sprach Zarathustra so ein, als sollte diese Liebe für den Leser ein einziges Fangnetz, gestrickt aus verschiedensten dramatischen Szenen und ideengeschichtlichen Bezügen, sein. Demgegenüber kann man aber auch mit der Erzählung gehen, um die schrittweise Problematisierung der Liebe Zarathustras aus der Innensicht zu verfolgen. Handelt es im ersten Teil der Erzählung um die Einschränkung der »Liebe zum Menschen« zur Liebe des Lehrers zu Schülern, so im zweiten Teil um Zarathustras Selbstliebe und im dritten Teil um die Liebe als amor fati. Tatsächlich treffen die beiden Linien der Lektüre im vierten Teil zusammen und binden den Ariadne-Faden: In der komödiantischen Auseinandersetzung mit den höheren Menschen erneuert sich die Liebe Zarathustras in einer Gestalt, die verspricht, gänzlich über die christliche Mitleidsmoral hinauszuführen.
Der Vortrag rückt den vierten Teil des Zarathustra in sein Zentrum, um die Befreiungsgeschichte, die Nietzsche erzählt, ›von hinten her‹ sichtbar zu machen.
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München
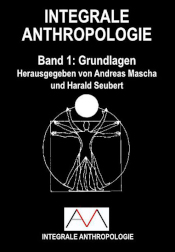
Einladung: Buchvorstellung
für Montag, den
23.01.2023
um 19.00 Uhr, in der
→ Seidlvilla
,
Nikolaiplatz 1b, München-Schwabing
(Kontakt +49 176 41754062).
Prof. Dr. Harald Seubert (Basel) und Andreas Mascha (München)
Integrale Anthropologie – Neue Horizonte
Bereits 1928 hat Max Scheler in der Vorrede zu seinem Werk „Die Stellung des Menschen im Kosmos“ auf den neuen anthropologischen Horizont und eine neue Form des Selbstbewusstseins und der Selbstanschauung des Menschen hingewiesen.
An diesen Horizont hat auch Karel Mácha mit seinen Beiträgen zu einer Integralen Anthropologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder angeschlossen. In der neuen Publikation „Integrale Anthropologie – Band 1: Grundlagen“ werden diese Impulse aufgenommen und auch interkulturell erweitert – mit einem besonderen Fokus auf den Integralen Yoga von Sri Aurobindo. Die Herausgeber dieses Bandes, Andreas Mascha und Prof. Dr. Harald Seubert, werden diesen Horizonteröffnungen an diesem Abend nachgehen. Weitere Infos zur Publikation unter: www.integraleanthropologie.de
Bitte bringen Sie interessierte Freunde und Bekannte mit!
Unkostenbeitrag € 10.-- / 5.-- (Mitglieder) / Studenten frei
Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München